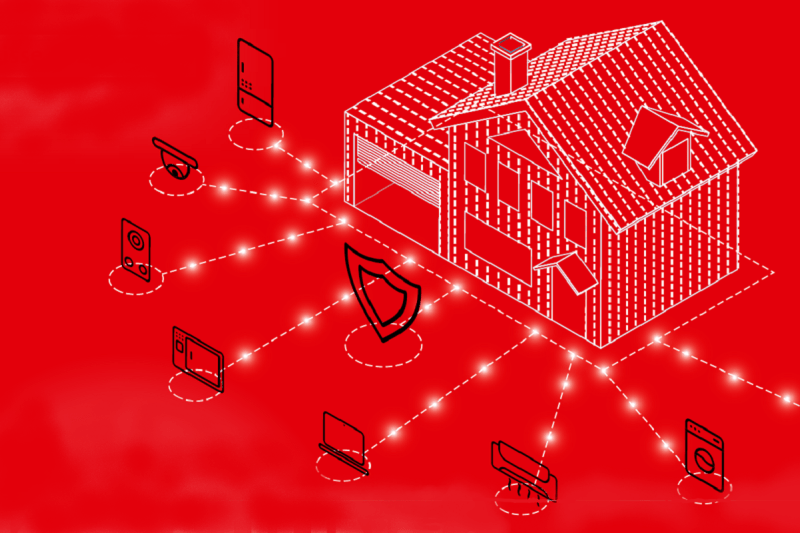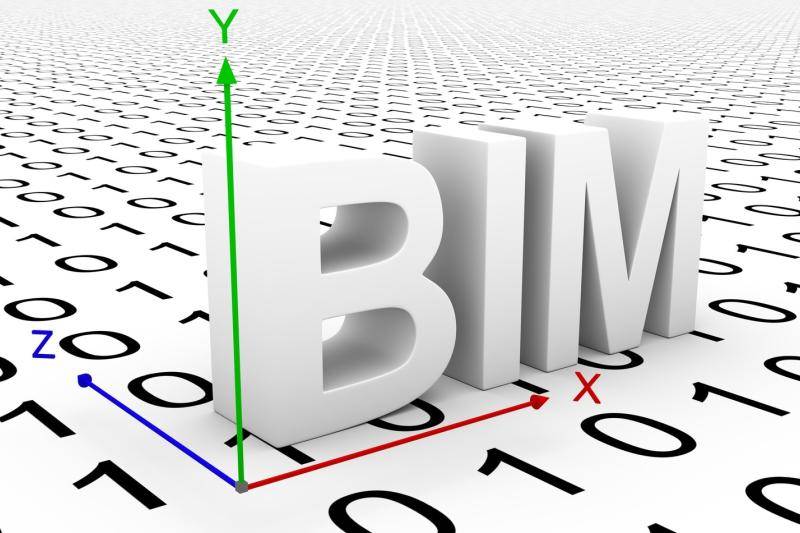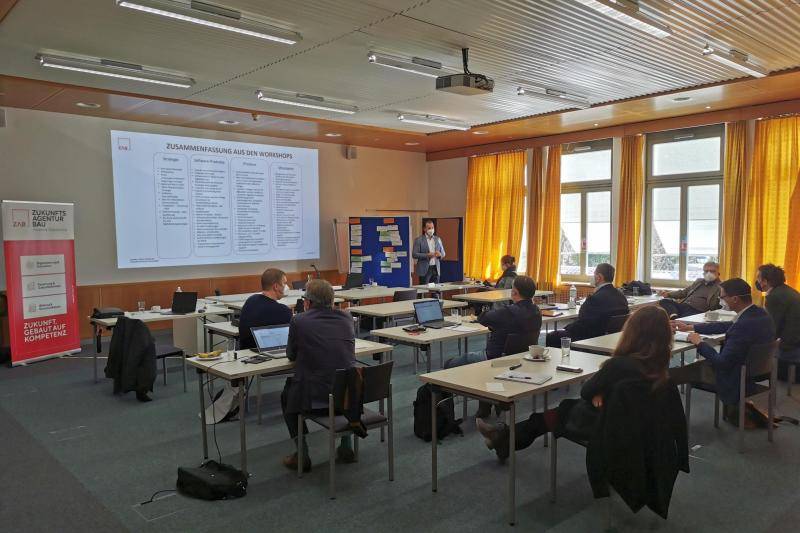TABs HP - Microlaboraufbau für Bauteilaktivierung 2.0 / Sbg
Ein Forschungsprojekt zur Kombination von Wärmepumpentechnologien mit aktivierbaren Speichermassen (Bauteilaktivierung) und zur Technologieentwicklung im mehrgeschossigen Wohnbau.
In der Kombination von Bauteilaktivierung und Wärmepumpentechnologien im mehrgeschossigen Wohnbau steckt ein enormes Potenzial für ein neuartiges Energiesystemmanagement. Genau hier setzte das Forschungsprojekt an, um durch Forschungsarbeiten zu wichtigen Fragen für die Planung, Regelung und Steuerung sowie Auslegung derartiger technologiekombinierter Systeme in Gebäuden Grundlagenwissen und eine methodische Evidenz schaffen.

Bauteilaktivierung mit Wärmepumpen als zukünftige Stromspeichertechnologie
Die Bauteilaktivierung, d.h. die Nutzung speicherwirksamer Massen in Gebäuden zur Speicherung von Energie, aber auch für Heizen und Kühlen bietet eine äußerst effiziente und nachhaltige Form der thermischen Konditionierung von Gebäuden und schafft durch großflächige und niedere Vorlauftemperaturen eine hohe Behaglichkeit. Neue Energietechnologien, wie das System der Wärmepumpen, das thermische Energie aus einem Reservoir mit niedrigerer Temperatur (Erdreich, Luft, Grundwasser etc.) aufnimmt und durch Antriebsenergie zu Heizwärme mit höherer Temperatur skaliert (Kraft- Wärme Prozess, praktisch Umkehrung des Kühlschrankprinzips) werden durch wachsende Effizienz- und Wirkungsgrade immer stärker eingesetzt.
Hinzu kommt ein Wandel im Bereich des Strommarktes, der durch stark wachsende, jedoch schwankende Anteile an erneuerbarem Strom (Sonnen- und Windenenergie) verstärkt Speichertechnologien erforderlich macht. Denn große Mengen an Strom stehen oftmals dann zur Verfügung, wenn sie nicht benötigt werden. Die Speichermöglichkeit von Pumpspeicherkraftwerken ist begrenzt, Speichertechnologien wie Batteriesysteme sind technisch bei weitem noch nicht ausgereift und wirtschaftlich einsetzbar, auch Systemkopplungen, wie „power to gas" sind vielfach noch im Prototypenstadium.
Hohes Potential in weitgehend unerforschtem Bereich des mehrgeschossigen Wohnbaus
Physische Baumassen über kostengünstige Rohrsysteme energetisch zu erschließen um sie als Speicher und über die großen Flächen als Niedertemperaturheiz- oder Kühlkörper zu nutzen, eröffnen das Feld für völlig neuartige Technologiesysteme. In der Kombination von Bauteilaktivierung und Wärmepumpentechnologien im mehrgeschossigen Wohnbau steckt enormes Potenzial für ein neuartiges Energiesystemmanagement.Das Gebäude wird damit zu einem intelligenten Systembaustein in künftigen Siedlungssystemen und ein wichtiger und einfacher Speicher für die Stromnetzanforderungen der Zukunft. Genau hier setzt das Forschungsprojekt an und soll durch Forschungsarbeiten zu wichtigen Fragen für die Planung, Regelung und Steuerung sowie Auslegung derartiger technologiekombinierter Systeme in Gebäuden Grundlagenwissen und eine methodische Evidenz schaffen.
Digitales MicroLabor als wissenschaftlicher Prototyp
Projektziel war es, mithilfe der dynamischen Gebäudesimulation bestehende Regelungsalgorithmen zu identifizieren und auf die Systemanforderungen der Bauteilaktivierung zu adaptieren und simulationstechnisch zu überprüfen. Zur dynamischen Gebäudesimulation wurde im Projekt ein protypischer Micro- Laborstand (Prüft-, Test-, Simulations- und Monitoringstand) entwickelt und gebaut, in dem einerseits Ideen zu neuartigen Gebäude- und Anlagensystemen nach Stand der Wissenschaft entwickelt, simuliert, verbessert und evaluiert werden können, insbesondere im Kontext komplexer mehrgeschossiger Wohnbauten, oder auch weitere Forschungsprojekte aufgesetzt werden können.
So konnten mit Projektende aus der dynamischen Gebäudesimulation Regelstrategien für die Praxis abgeleitet werden, um mithilfe der erlangten Erkenntnisse die Implementierung in der Praxis zu ermöglichen.
DOWNLOADS/LINKS
Förderung
Land Salzburg, Bereich Wirtschafts-und Forschungsförderung